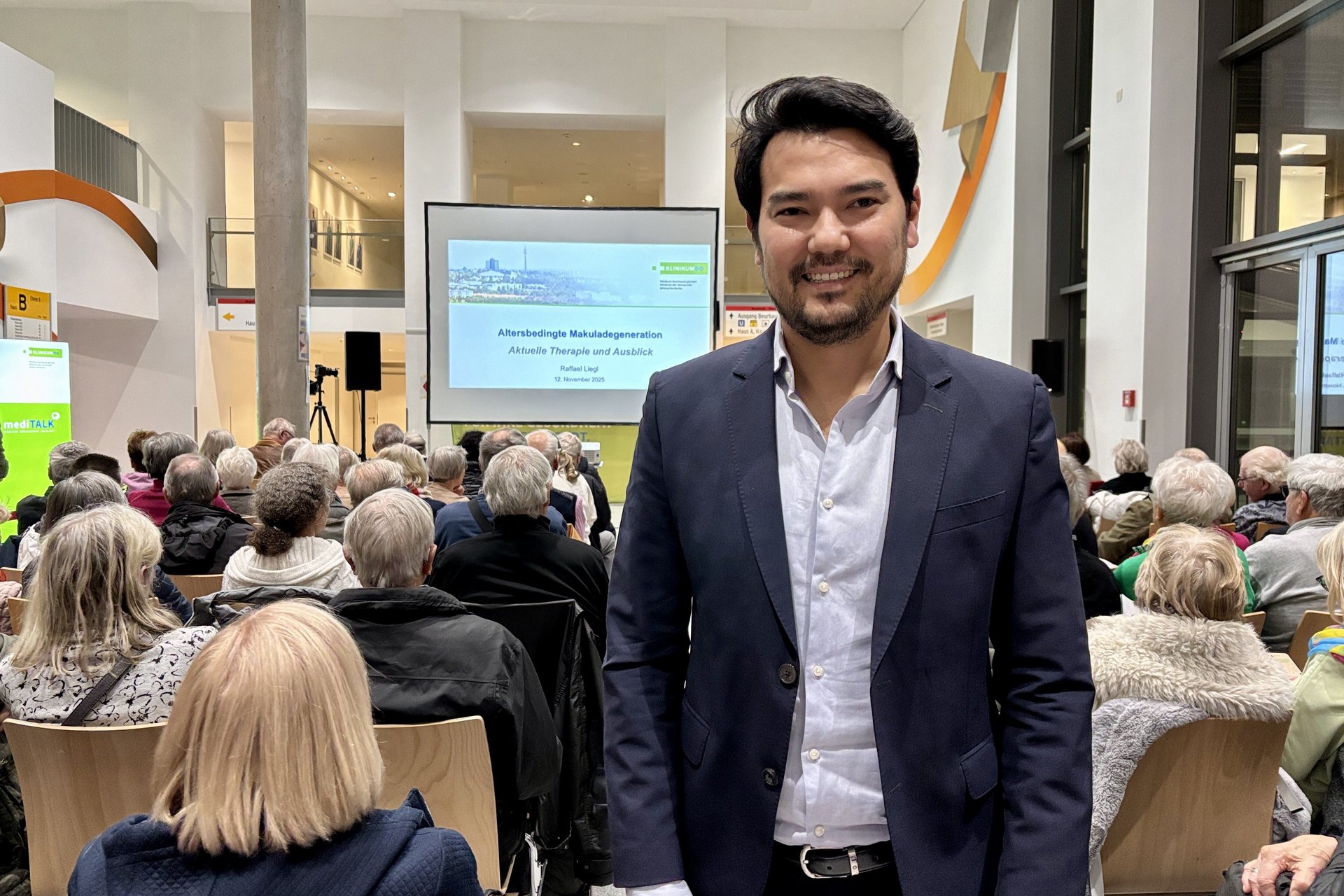Die altersabhängige Makuladegeneration (AMD) stellt in Deutschland die häufigste Ursache für Erblindung im höheren Lebensalter dar. Rund ein Drittel der über 75-Jährigen ist von einer Form dieser Erkrankung betroffen. Angesichts dieser hohen Relevanz widmete sich Priv.-Doz. Dr. Raffael Liegl, Leiter der Augenklinik am Klinikum Dortmund, dem Thema in der November-Ausgabe des mediTALKs. Etwa 140 Interessierte folgten am 12. November der Einladung in die Magistrale des Klinikums, um sich aus erster Hand zu informieren.
Die Makula, der zentrale Bereich der Netzhaut, ist entscheidend für das scharfe Sehen. Hier sitzen spezialisierte Photorezeptoren, die visuelle Informationen aufnehmen. Kommt es infolge krankhafter Veränderungen zu Fett- und Stoffwechselablagerungen unter der Netzhaut, wird die Versorgung dieser Sinneszellen beeinträchtigt. Während frühe Stadien oft symptomarm verlaufen, können im weiteren Verlauf deutliche Seheinschränkungen auftreten.
Erkrankung mit verschiedenen Faktoren
Die AMD gilt als multifaktorielle Erkrankung: Verschiedene Einflüsse wie genetische Faktoren, Diabetes mellitus und ein ungesunder Lebensstil können das Risiko erhöhen. „Ich rate Ihnen dringend – und bei bekannter AMD umso mehr – vollständig auf das Rauchen zu verzichten“, appellierte Dr. Liegl an das Publikum.
Im Spätstadium zeigt sich die AMD in zwei Formen: der trockenen Form, die durch den fortschreitenden Untergang von Netzhautzellen (Atrophie) geprägt ist, und der feuchten Form, bei der sich krankhafte neue Blutgefäße bilden. Ein erstes Warnsignal für Letztere kann der Amsler-Test sein, bei dem Betroffene ein kariertes Gitter betrachten. „Wenn Linien verzogen oder verbogen wirken, sollten Sie zeitnah einen Augenarzt aufsuchen“, betonte Dr. Liegl. Eine sichere, schmerzfreie Diagnose ist unter anderem mittels optischer Kohärenztomographie möglich.
Vorsicht bei vermeintlich innovativen Ansätzen
„Eine heilende Therapie gibt es leider noch nicht“, erläuterte Dr. Liegl. Der Krankheitsverlauf könne bislang nicht rückgängig gemacht werden, was viele Betroffene anfällig für kostspielige, jedoch wissenschaftlich nicht belegte Behandlungsmethoden mache. Vor vermeintlich innovativen Ansätzen wie Spezialbrillen oder Lasertherapien warnte er daher eindringlich: „Es gibt derzeit keine ausreichende Evidenz für deren Nutzen.“
Während für die trockene AMD weiterhin keine zugelassene Therapie zur Verfügung steht, hat sich das Behandlungsspektrum der feuchten Form in den vergangenen Jahren deutlich erweitert. Medikamente, die mittels Injektion ins Auge verabreicht werden, können das Fortschreiten der Erkrankung bremsen und das Sehvermögen stabilisieren – erfordern jedoch regelmäßige Wiederholungsbehandlungen.
Neue Injektionsmethode
Dr. Liegl, der zuvor eines der größten deutschen Studienzentren für Netzhauterkrankungen leitete, ist an einer Vielzahl innovativer Forschungsprojekte beteiligt. Einige dieser Entwicklungen könnten bereits in naher Zukunft neue Therapieoptionen eröffnen. So wird im kommenden Jahr voraussichtlich das sogenannte Port Delivery System eingeführt, das bei ausgewählten Patientinnen und Patienten die Zahl der erforderlichen Injektionen erheblich reduzieren könnte. „Unsere Augenklinik am Klinikum Dortmund wird zu den ersten Zentren in Deutschland gehören, die dieses System anwenden dürfen“, kündigte Dr. Liegl an.
Wer den mediTALK verpasst hat, kann die Veranstaltung nachträglich auf Youtube oder Spotify verfolgen.